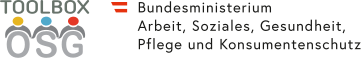Für die adäquate Versorgung benötigen die Opferschutzgruppen neben einem weitreichenden Expertenwissen auch Kenntnisse von regionalen Anlaufstellen und Betreuungsnetzen für Gewaltopfer und auch das Wissen um die eigenen Grenzen.
Die Gespräche mit Gewaltopfern können für Gesundheitsfachkräfte belastend sein und Gefühle von Überforderung, Ohnmacht und Wut auslösen. Andererseits können Rettungsfantasien entstehen: „Wenn ich jetzt nicht helfe, dann hilft der Frau niemand und die Frau ist verloren“ (Gynécologie Suisse 2009). Dieser realitätsferne Ansatz kann zu „blindem“ Aktivismus führen, der letztlich in Überforderung endet. Deshalb ist ein sachliches Herangehen, d. h. die eigenen Grenzen wahrzunehmen, klar zu benennen und bewusst zu setzen, wichtig. Das gilt sowohl in zeitlicher als auch in emotionaler Hinsicht.
Der Kontakt mit Gewaltopfern oder die Konfrontation mit Gewalt in der Ambulanz oder auf der Station können Erinnerungen an eigene Gewalterfahrungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auslösen. Laut einer Schweizer Studie gibt jede/r vierte Angestellte eines Krankenhauses an, selbst Gewalt durch eine nahestehende Person erlitten zu haben (Gynécologie Suisse 2009). Eigene Erfahrungen gehen mit einer hohen Sensibilität für die Gewaltproblematik einher. Wenn das eigene Trauma verarbeitet ist, stellen solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders wertvolle Expertinnen und Experten für das Krankenhaus dar. Jedoch ist der Kontakt mit diesem Patientenklientel, wenn man selbst Gewalt erfahren hat, zusätzlich belastend. Und es besteht die Gefahr einer neuerlichen Traumatisierung. In diesen Fällen ist es dringend geboten, die Versorgung der gewaltbetroffenen Personen einer Kollegin / einem Kollegen zu übertragen und für sich selbst Unterstützung in Anspruch zu nehmen (Gruber/Logar 2015).
Der regelmäßige Erfahrungsaustausch innerhalb der Opferschutzgruppe bzw. im Kollegenkreis kann entlasten und ist für die weitere Arbeit mit Gewaltbetroffenen notwendig. Für den psychosozialen Krisenfall stehen auch professionelle Unterstützungsmaßnahmen seitens der Spitäler in unterschiedlichem Ausmaß bereit. Dazu zählen u.a. Krisengespräche mit einem klinischen Psychologen / einer klinischen Psychologin, die Beratung durch den Arbeitspsychologen / die Arbeitspsychologin, den Arbeitsmedizinerin / die Arbeitsmedizinerin etc. Externe Supervisionen sollten grundsätzlich alsÜberdies ist die externe Supervision ein Bestandteil der Qualitätssicherung und sollte für alle Opferschutzgruppen bereitgestellt werden. Diese dient der Optimierung der Behandlung, der Entlastung und Unterstützung der Fachkräfte sowie der Burn-out-Prophylaxe (Fausch/Wechlin 2007).
Einige Krankenanstalten verweisen mittlerweile auf interne “Guidelines für den Umgang mit belastenden Situationen und Krisen am Arbeitsplatz”.
Der Verein Second Victim bietet ein kostenfreies Beratungs- und Therapieangebot für medizinisches Personal in besonderen Belastungssituationen.